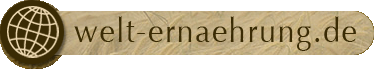Phosphor: Fluch und Segen eines Elements
von Peter Clausing Der europäische Phosphorzyklus könnte vollständig geschlossen werden, wenn die importierten chemischen Phosphatdünger komplett gegen biologische und recyclte chemische Phosphordünger ersetzt würden. Damit stiege die Wasserqualität in Europa und viele andere Probleme wären gelöst. Doch um das zu erreichen, müsste das Diktat der »Marktkräfte« überwunden werden. Phosphor ist ein lebensnotwendiges chemisches Element. Sowohl im menschlichen Körper als auch in Pflanzen beträgt sein Anteil zwar nur zirka ein Prozent. Ohne Phosphor gäbe es aber kein Leben in seiner jetzigen Form. Er ist Baustein der Erbinformation DNS, von Proteinen und Enzymen. Die Freisetzung und Speicherung von Energie in den Zellen von Tieren und Pflanzen erfolgt unter obligatorischer Beteiligung von Phosphor. Im Pflanzenbau ist Phosphor unverzichtbar und kann durch nichts ersetzt werden. Daraus folgt, dass eine Landwirtschaft, die nicht auf geschlossenen Kreisläufen basiert, letztlich auf Phosphorzufuhr von außen angewiesen ist. Nach Verarbeitung des Rohphosphats wird der Phosphor in pflanzenverfügbarer Form in den Boden eingebracht, zumeist als Diphosphat, das wenig wasserlöslich ist,...
Lesezeit: 9 Minuten„Sauerei!“ – Bauer Willis misslungene Demagogie (Rezension)
von Peter Clausing „Sauerei!“ hätte ein gutes Buch werden können. Es ist flüssig geschrieben, wenngleich etwas distanzlos-kumpelhaft, aber das trifft sicher den Nerv vieler Leserinnen und Leser. Und der Verfasser ist ein echter Insider. Kremer-Schillings bewirtschaftet 50 Hektar, den gleichen Hof wie sein Vater und sein Großvater. Er schöpft aus dem Vollen, was die Beschreibung des Lebens eines Landwirts anbetrifft – und das über drei Generationen. Aber „Sauerei“ ist im besten Fall ein ärgerliches Buch, eher aber ein gefährliches, wenn man dem Aphorismus von Georg Christoph Lichtenberg folgt, der schon im 18. Jahrhundert erkannte: „Das Gefährliche sind nicht die dicken Lügen, sondern Wahrheiten, mäßig entstellt.“ Das Buch charakterisiert detailreich die Krise der deutschen und europäischen Landwirtschaft, um dann den Popanz des „Verbrauchers“ aufzubauen, der an der Misere des Landwirts schuld sei und in dessen Macht es läge, daran etwas zu ändern. Das soll uns nicht von verantwortungsvollem Verbrauch freisprechen. Doch damit allein wird das Problem nicht gelöst. Es ist nicht...
Lesezeit: 3 MinutenPrivate Stiftungen – Speerspitze der globalen Agrarkonzerne?
Von Peter Clausing Die „neuen Philanthropen“, wie sich die Milliardäre des 21. Jahrhunderts nennen, schaffen mit ihren Stiftungen unter Umgehung demokratischer Entscheidungsprozesse die Voraussetzungen für die Ausdehnung der Märkte transnationaler Konzerne. Verbrämt durch einen Diskurs der Armutsbekämpfung, fördern sie die Entstehung einer neuen agrarischen Mittelschicht im subsaharischen Afrika, die ausreichend zahlungskräftig ist, um sich die Segnungen einer neuen Grünen Revolution leisten zu können. Mangel an Demokratie ist eine wesentliche Voraussetzung dafür. Zwar behauptet die Grüne Revolution 2.0, dass sie die afrikanischen KleinbäuerInnen aus der Armutsfalle ziehen wolle, doch gerade diese profitieren nicht davon! Die eigentlichen Nutznießer des neuen landwirtschaftlichen Booms sind – wie Untersuchungen in Kenia und Sambia zeigen – reiche Städter, in der Mehrzahl Regierungsangestellte, die sich in die Landwirtschaft einkaufen. Das erste Anzeichen für eine neue „Grüne Revolution“ gab es 1997, als Gordon Conway, der kurz darauf zum Präsidenten der Rockefeller-Stiftung ernannt wurde, sein Buch „The Doubly Green Revolution: Food for All in the Twenty-first Century”, veröffentlichte (1)....
Lesezeit: 14 MinutenLandgrabbing
Auf den 5. Heppenheimer Tagen zur christlichen Gesellschaftsethik ging es um Fragen des Bodeneigentums aus unterschiedlichsten Perspektiven Thesen zum Thema Landgrabbing von Peter Clausing 1. Einerseits wird die Verabschiedung der freiwilligen Leitlinien der FAO (Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security) im Jahr 2012 als großer Erfolg betrachtet, auch deshalb, weil diese Leitlinien sehr bald nach dem kritisierten Weltbankbericht zum Thema Landgrabbing (Deininger und Byerlee 2011) verabschiedet wurde. Andererseits kann Landgrabbing nicht losgelöst von anderen Politikfeldern betrachtet werden, die das Landgrabbing bedingen bzw. beeinflussen oder selbst vom Landgrabbing beeinflusst werden. Dazu gehören u.a.: – Handelspolitik allgemein, insbesondere aber die Liberalisierung von Börsengeschäften mit Nahrungsmitteln (Spekulation); – Politik bezüglich Ernährungsgewohnheiten (Fleischkonsum, Vergeudung von Lebensmitteln, Dumpingpreise); – Klima-, Energie- und Biodiversitätspolitik (Agrotreibstoffe, Landnutzungsänderungen, Schutzgebiete); – Förderung bestimmter Modelle landwirtschaftlicher Produktion (ungenügende bzw. nur Alibi-mäßige Förderung von Alternativen zu input-intensiver, profit-orientierter Landwirtschaft); – Migrationspolitik; – Informationspolitik (Beispiel: das Fehlen ökonomischer Hintergrundinformationen, inklusive...
Lesezeit: 10 MinutenEin diskursives Hungergespenst
von Peter Clausing Nicht selten ruft die Frage, ob und unter welchen Bedingungen die wachsende Weltbevölkerung ausreichend ernährt werden kann, Ratlosigkeit und Unbehagen hervor. Eine negative Antwort würde den Hungertod Hunderter Millionen Menschen mit kaum vorstellbaren gesellschaftlichen Folgen bedeuten. Schließlich sind schon heute zirka 850 Millionen Menschen unterernährt, was bedeutet, dass alljährlich etwa 10 Millionen Menschen an Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen sterben. Die Frage, was getan werden müsste, um bei gleichzeitig wachsender Weltbevölkerung von diesem Genozid wegzukommen, wird sehr unterschiedlich beantwortet. Zunächst ist festzuhalten, dass ein allgemeiner Konsens darüber besteht, dass die Weltbevölkerung nach 2050 nur noch unwesentlich zunehmen wird. Zwar werden in 35 Jahren voraussichtlich zwei Milliarden (30 Prozent) mehr Menschen auf der Erde leben als heute, jedoch bei stetig abnehmendem Bevölkerungswachstum. Nun vertreten Weltbank und Welternährungsorganisation (FAO) die Ansicht, dass dann, wenn 30 Prozent mehr Menschen die Welt bevölkern, 70 Prozent mehr Nahrungsmitteln zur Verfügung stehen müssten. Die Diskrepanz zwischen den 70 und 30 Prozent wird mit...
Lesezeit: 3 MinutenEnergieschleuder Agrarindustrie
von Peter Clausing In den letzten Jahrzehnten sind die Hektarerträge der industriellen Landwirtschaft erheblich gestiegen. Erkauft wurde dieser Zuwachs mit einem extrem hohen Einsatz fossiler Energieträger. Doch inzwischen ist die Euphorie über die Wunder der „grünen Revolution“ verflogen und es macht sich Ernüchterung breit. Trotz des fortgesetzten Einsatzes erdölbasierter Ressourcen stagnieren die Erträge oder sinken sogar. Eine wesentliche Ursache ist die nachlassende Bodenfruchtbarkeit aufgrund der vernachlässigten organischen Düngung und der Versalzung bewässerter Böden in semiariden Regionen. Mehr Aufwand als Ertrag Seit der Erdölkrise Mitte der 1970er-Jahre interessieren sich Wissenschaftler verstärkt für die Energiebilanzen landwirtschaftlicher Produktion. Fasst man die gewonnenen Erkenntnisse zusammen, wird schnell klar: Bei industriemäßiger Großflächenwirtschaft wird mehr (fossile) Energie verbraucht, als am Ende in der verzehrten Nahrung steckt (Pimentel, 1980). Außer jener Energie, die in der eigentlichen Produktion steckt, werden auch die für den Transport zu den Märkten und zur Herstellung von Verpackungsmaterial aufgewendete Energie und weitere Faktoren berücksichtigt. Daraus ergibt sich in der intensiven Landwirtschaft ein Aufwand...
Lesezeit: 5 MinutenIntensiv und ineffizient
Die industrielle Landwirtschaft ist an den Verbrauch fossiler Brennstoffe gekoppelt. Die Energiebilanz ihrer Produkte ist negativ. Von Peter Clausing Alljährlich am 17. April hat die globale Kleinbauernorganisation La Via-Campsina ihren Aktionstag. Die Organisation sagt, daß Kleinbauern energieeffizienter produzieren als Großbetriebe. Seit Jahrtausenden besteht der Sinn des Ackerbaus in der Umwandlung von Sonnenenergie in »essbare«. Das geschieht mit Hilfe der Photosynthese, deren Effizienz zwar gering ist, denn jener Anteil der eingestrahlten Sonnenenergie, der in Biomasse umgewandelt wird, beträgt weniger als zwei Prozent. Trotzdem wird über das Jahr und die Fläche verteilt in Früchten und Knollen genügend Energie akkumuliert, um die Weltbevölkerung zu versorgen. Die Sonnenstrahlung steht gratis zur Verfügung. Der Anteil an Energie, der darüber hinaus in die Erzeugung und Verarbeitung von Nahrung gesteckt wurde, war für lange Zeit von geringer Bedeutung. Diese Situation hat sich in den vergangenen hundert Jahren dramatisch geändert. Zwar wurden in den letzten Jahrzehnten in vielen Teilen der Welt die Hektarerträge erheblich gesteigert. Erkauft wurde dieser...
Lesezeit: 10 MinutenFünf Mal so viele Schweine wie Menschen
Industrielle Schweinemast in Mexiko: Granjas Caroll/Smithfield Von Peter Clausing Industrielle Schweinmastanlagen zerstören die Umwelt und rufen gesundheitliche Schäden hervor. Sie verunreinigen das Grundwasser sowie Oberflächengewässer und können Atembeschwerden, Nierenprobleme und andere Erkrankungen hervorrufen. Untersuchungen belegen die psychischen Wirkungen des permanenten Gestanks, den Mastfabriken erzeugen. All das bekommen auch die BewohnerInnen des Perote-Tals im mexikanischen Bundesstaat Veracruz zu spüren. Doch es bedurfte erst des Ausbruchs der vom H1N1-Virus hervorgerufenen Schweinegrippe im Jahr 2009, um die dortigen Verhältnisse ins Rampenlicht der internationalen Öffentlichkeit zu rücken. Der Ursprung dieser zeitweise von der Weltgesundheitsorganisation als globale Epidemie (Pandemie) eingestuften Grippewelle ließ sich in den Ort La Gloria zurückverfolgen, der sich in unmittelbarer Nähe zu einer der Mastfabriken des Unternehmens Granjas Carroll (GC) befindet. In Mexiko fand in den letzten Jahrzehnten ein wirtschaftlicher Konzentrationsprozess statt, in Folge dessen heutzutage 60 Prozent des Schweinefleischs in „technologisch fortgeschrittenen“ Betrieben produziert wird, was für den 150 Quadratkilometer großen Landkreis Perote (die Hälfte der Fläche von München) bedeutet, dass...
Lesezeit: 3 MinutenSprengt die Wertschöpfungsketten !!
Von Peter Clausing Den offiziellen Start von vier Großprojekten des »German Food Partnership«-Programms (GFP) am 5.11.2013 nahmen mehrere Nichtregierungsorganisationen zum Anlass, diese »Entwicklungspolitik im Dienst deutscher Konzerne« scharf zu kritisieren. Das Forum Umwelt und Entwicklung forderte, »das FDP-Projekt unverzüglich zu stoppen«, und Jan Urhahn, Landwirtschaftsexperte des entwicklungspolitischen Netzwerks INKOTA, hob hervor, daß die Bundesregierung mit GFP unter dem Deckmantel von Hunger- und Armutsbekämpfung einseitig die Wirtschaftsinteressen deutscher und europäischer Unternehmen wie BASF, Bayer Crop Science oder Syngenta bediene. Neben den transnationalen Agrarkonzernen finden sich unter den zehn GFP-Partnern auch die Handelskette Metro, der Verband der Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen und die Düngemittelindustrie. Bereits die Zusammensetzung dieser »Partnerschaft« lässt erkennen, dass es um die Schaffung vertikal integrierter Wertschöpfungsketten geht, bei denen bekanntlich der Wert vor allem am unteren Ende der Kette von den Bäuerinnen und Bauern geschaffen und dann schrittweise nach oben transferiert wird. Mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 78 Millionen Euro werden eine »Kartoffel-Initiative«, eine »Ölsaaten-Initiative« und eine »Konkurrenzfähige Reis-Initiative« in...
Lesezeit: 3 MinutenMexiko-Lateinamerika: Tödliche Pestizide
von Alfredo Acedo* (Quito, 14. Oktober 2011, alai).- Der grün und ockerfarben gemusterte Teppich des Valle del Yaqui ist zwar schön anzusehen, er verbirgt jedoch eine Tragödie, die sich in dieser Region abspielt. Unter dem kapitalistischen Landwirtschaftsmodell wurden hier über 50 Jahre intensiv Pflanzenschutzmittel eingesetzt, wodurch Wasser, Böden und Luft verschmutzt und die Region damit praktisch zerstört wurde. Doch nicht nur die Natur trägt die verheerenden Konsequenzen. Die unverantwortlichen Praktiken haben auch Menschenleben gefordert. Vergiftungssymptome nach der Feldarbeit Das im Süden des nordöstlichen Bundesstaats Sonora gelegene Tal erstreckt sich über ein Gebiet von mehr als 225.000 Hektar und wird hauptsächlich schwerkraftbewässert. Dort werden vor allem Weizen (65 Prozent der mexikanischen Weizenproduktion), Mais, Wolle, Gemüse und Grünfutter angebaut. Ich bin in einem kleinen Dorf südlich der Stadt Obregón inmitten der Anbauflächen geboren und habe bis zur Pubertät dort gelebt. Oft sah ich meinen Vater mit Vergiftungssymptome von der Arbeit heimkehren. Er arbeitete mit verschiedenen Maschinen, wie zum Beispiel Traktoren, die Pestizide,...
Lesezeit: 7 Minuten