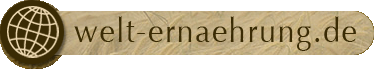Landungerechtigkeit: Hunger und Migration
Der chronische Nahrungsmangel im subsaharischen Afrika hängt mit der Ungleichheit im Besitz von Grund und Boden zusammen. Eine Abwanderung in die Städte lindert die Not in der Regel nicht. Von Peter Clausing In den Ländern südlich der Sahara, dem sogenannten subsaharische Afrika, leben über 200 Millionen chronisch hungernde Menschen – das sind etwa 30 Prozent der dortigen Bevölkerung. Davon sind vor allem die auf dem Land lebenden Menschen betroffen, für die »chronischer Hunger« zumeist bedeutet, dass er alljährlich wiederkehrt, nämlich dann, wenn die eigenen Vorräte zur Neige gehen und das Geld nicht reicht, um zusätzliche Lebensmittel zu kaufen. Diese Periode kann mehrere Wochen bis mehrere Monate dauern – je nachdem wie die vorherige Ernte ausfiel. Typisch ist das für Betriebe, bei denen die landwirtschaftlich bearbeitete Fläche unter einer Größe von zwei Hektar liegt. 80 Prozent der afrikanischen Bäuerinnen und Bauern bewirtschaften derart kleine Flächen und ernähren damit mehr schlecht als recht eine oftmals sechs- bis achtköpfige Familie. In Malawi zum...
Lesezeit: 9 MinutenEin diskursives Hungergespenst
von Peter Clausing Nicht selten ruft die Frage, ob und unter welchen Bedingungen die wachsende Weltbevölkerung ausreichend ernährt werden kann, Ratlosigkeit und Unbehagen hervor. Eine negative Antwort würde den Hungertod Hunderter Millionen Menschen mit kaum vorstellbaren gesellschaftlichen Folgen bedeuten. Schließlich sind schon heute zirka 850 Millionen Menschen unterernährt, was bedeutet, dass alljährlich etwa 10 Millionen Menschen an Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen sterben. Die Frage, was getan werden müsste, um bei gleichzeitig wachsender Weltbevölkerung von diesem Genozid wegzukommen, wird sehr unterschiedlich beantwortet. Zunächst ist festzuhalten, dass ein allgemeiner Konsens darüber besteht, dass die Weltbevölkerung nach 2050 nur noch unwesentlich zunehmen wird. Zwar werden in 35 Jahren voraussichtlich zwei Milliarden (30 Prozent) mehr Menschen auf der Erde leben als heute, jedoch bei stetig abnehmendem Bevölkerungswachstum. Nun vertreten Weltbank und Welternährungsorganisation (FAO) die Ansicht, dass dann, wenn 30 Prozent mehr Menschen die Welt bevölkern, 70 Prozent mehr Nahrungsmitteln zur Verfügung stehen müssten. Die Diskrepanz zwischen den 70 und 30 Prozent wird mit...
Lesezeit: 3 MinutenIntensiv und ineffizient
Die industrielle Landwirtschaft ist an den Verbrauch fossiler Brennstoffe gekoppelt. Die Energiebilanz ihrer Produkte ist negativ. Von Peter Clausing Alljährlich am 17. April hat die globale Kleinbauernorganisation La Via-Campsina ihren Aktionstag. Die Organisation sagt, daß Kleinbauern energieeffizienter produzieren als Großbetriebe. Seit Jahrtausenden besteht der Sinn des Ackerbaus in der Umwandlung von Sonnenenergie in »essbare«. Das geschieht mit Hilfe der Photosynthese, deren Effizienz zwar gering ist, denn jener Anteil der eingestrahlten Sonnenenergie, der in Biomasse umgewandelt wird, beträgt weniger als zwei Prozent. Trotzdem wird über das Jahr und die Fläche verteilt in Früchten und Knollen genügend Energie akkumuliert, um die Weltbevölkerung zu versorgen. Die Sonnenstrahlung steht gratis zur Verfügung. Der Anteil an Energie, der darüber hinaus in die Erzeugung und Verarbeitung von Nahrung gesteckt wurde, war für lange Zeit von geringer Bedeutung. Diese Situation hat sich in den vergangenen hundert Jahren dramatisch geändert. Zwar wurden in den letzten Jahrzehnten in vielen Teilen der Welt die Hektarerträge erheblich gesteigert. Erkauft wurde dieser...
Lesezeit: 10 MinutenSprengt die Wertschöpfungsketten !!
Von Peter Clausing Den offiziellen Start von vier Großprojekten des »German Food Partnership«-Programms (GFP) am 5.11.2013 nahmen mehrere Nichtregierungsorganisationen zum Anlass, diese »Entwicklungspolitik im Dienst deutscher Konzerne« scharf zu kritisieren. Das Forum Umwelt und Entwicklung forderte, »das FDP-Projekt unverzüglich zu stoppen«, und Jan Urhahn, Landwirtschaftsexperte des entwicklungspolitischen Netzwerks INKOTA, hob hervor, daß die Bundesregierung mit GFP unter dem Deckmantel von Hunger- und Armutsbekämpfung einseitig die Wirtschaftsinteressen deutscher und europäischer Unternehmen wie BASF, Bayer Crop Science oder Syngenta bediene. Neben den transnationalen Agrarkonzernen finden sich unter den zehn GFP-Partnern auch die Handelskette Metro, der Verband der Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen und die Düngemittelindustrie. Bereits die Zusammensetzung dieser »Partnerschaft« lässt erkennen, dass es um die Schaffung vertikal integrierter Wertschöpfungsketten geht, bei denen bekanntlich der Wert vor allem am unteren Ende der Kette von den Bäuerinnen und Bauern geschaffen und dann schrittweise nach oben transferiert wird. Mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 78 Millionen Euro werden eine »Kartoffel-Initiative«, eine »Ölsaaten-Initiative« und eine »Konkurrenzfähige Reis-Initiative« in...
Lesezeit: 3 MinutenMalawi im Prisma der Welternährungskrise
von Peter Clausing Malawi, ein kleines Land im Herzen Afrikas, gehört mit seinen 14 Millionen Bewohnern zu den am dichtesten besiedelten Ländern Afrikas, nur übertroffen von Burundi, Gambia, Nigeria und Ruanda. Seine Ernährungsprobleme und die entsprechenden Lösungsversuche reflektieren eine ganze Reihe von Aspekten der globalen Ernährungskrise. Aufgrund des hohen Bevölkerungswachstums hat sich die Einwohnerzahl seit 1950 mehr als vervierfacht. Trotzdem liegt die Bevölkerungsdichte mit 120 Einwohner/km² noch immer deutlich unter der von Deutschland (229 Einwohner/km²). Malawi zählt zu den Least Developed Countries (LDC), einer sozialökonomischen Definition der UNO für die 48 ärmsten Länder der Welt. Trotz innenpolitischer Stabilität und obwohl das Land nicht vom „Ressourcenfluch“ heimgesucht ist, den der konservative Ökonom Paul Collier in fragwürdiger Weise als Wurzel allen Übels der Armut in Afrika betrachtet (1), hat das Land – seit langem ein Liebling der internationalen Entwicklungshilfe – es bis heute nicht geschafft, den LDC-Status zu verlassen. Schlimmer noch – in den letzten Jahrzehnten kam es wiederholt zu Hungersnöten, bei...
Lesezeit: 4 MinutenHunger – Katastrophe, Protest und Medienereignis
Wo liegen die Gründe für die skandalöse Diskrepanz zwischen Produktion und Versorgung? Von Peter Clausing Hunger ist die Alltagsrealität für ein Sechstel der Menschheit und – hungerbedingte Krankheiten mitberücksichtigt – die Todesursache für 10 Millionen Menschen jährlich. Spätestens seit der Explosion der Nahrungsmittelpreise 2007/2008 ist klar, dass das Milleniums-Entwicklungsziel, den Anteil der Menschen, die Hunger leiden, von 1990 bis 2015 zu halbieren, nicht annähernd erreicht werden wird. Statt zu einer Reduzierung kam es 2008 zu einem Anstieg der Zahl der Hungernden. Dabei wird Jahr für Jahr genügend produziert, um – statistisch betrachtet – alle Menschen mit ausreichend Nahrung zu versorgen.
Marktfrauen in Zomba, Malawi
Peak Soil I – Hunger nach Land
Hintergrund »Peak Soil« – Bodenzerstörung, Landraub und Ernährungskrise. Teil I: Wie Konzerne und Spekulanten von der Verknappung von Lebensmitteln profitieren Peter Clausing »Peak Soil«1 lautet der Titel des 2009 erschienenen Buches des Berliner Autors Thomas Fritz, einer ersten umfassenderen Übersicht zum Thema »Land Grabbing« (Landnahme) in deutscher Sprache. Der Begriff »Land Grabbing« bezieht sich auf den Kauf bzw. die langfristige Pachtung großer Landflächen – vor allem in den Ländern des Südens, aber auch in Osteuropa – mit oft drastischen Auswirkungen auf die Lebenswirklichkeit der Bevölkerung. Die Ansichten, ab wann von »großen Landflächen« zu sprechen ist, divergieren. Während Olivier de Schutter, Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Recht auf Nahrung, 1000 Hektar als Untergrenze betrachtet, definierte die Nichtregierungsorganisation (NGO) GRAIN 10000 Hektar als unteres Limit. Entsprechend der Bedeutung dieses bedrohlichen Phänomens ist inzwischen eine Reihe von Publikationen erschienen, und es fanden zahlreiche nationale und internationale Tagungen zum Thema statt. »Land Grabbing, so scheint es, kommt wie ein Tsunami über die Welt,...
Lesezeit: 10 MinutenSchönredner bei der FAO
Aus: land & wirtschaft, junge Welt-Beilage vom 04.08.2010 von Peter Clausing Landnahme durch private Investoren in Afrika und Lateinamerika erreicht dramatische Dimensionen. UN-Ernährungsorganisation, Weltbank und Entwicklungspolitiker betonen »Chancen« »Man muß kein Bauer sein, um mit Ackerland Geld zu verdienen«, hieß es in einem Beitrag der Wochenzeitung Die Zeit vom 11. Februar 2010, der sich mit einem Trend beschäftigte, über den in den letzten zwei Jahren viel geschrieben und diskutiert wurde, ohne daß es seither zu einer Trendwende gekommen ist. Die Rede ist von der rasanten Aneignung des Produktionsmittels Boden durch Investoren und – seit der Preisexplosion im Nahrungsmittelbereich 2008 – durch finanzstarke Länder mit prekärer Eigenversorgung, international unter dem Begriff Land Grabbing bekannt. Die Berichterstattung in den Medien vermittelt den Eindruck, daß es vor allem die Regierungen Chinas, Südkoreas und der Golfstaaten seien, die diese Landumverteilung vorantreiben. Eine repräsentative Analyse des Londoner International Institute for Environment and Development (IIED) zeigte aber am Beispiel von Äthiopien, Ghana, Madagaskar und Mali, daß...
Lesezeit: 4 MinutenKommentiert: The Coming Food Coups by Natsios & Doley
In ihrem Beitrag „The Coming Food Coups“, der im Januar 2009 im Washington Quartely erschien, das vom Center for Strategic and International Studies herausgegeben wird, befassen sich Natsios und Doley mit den humanitären, politischen und Sicherheitskonsequenzen der Preisexplosionen bei Nahrungsmitteln. Dabei ist für sie die Famine Theory ein hilfreiches Werkzeug, also die Theorie von den Hungersnöten, „a body of knowledge about the microeconomic dynamics of famines, the vulnerability of people to food price shocks, and the common patterns of behavior people use to try to survive in different stages of a famine„. Ihrer Meinung nach müssen Politiker ausgerüstet sein, um die Sicherheits- (und andere) Konsequenzen derartiger Entwicklungen zu minimieren. Dabei betrachten sie – im Gegensatz zu Paul Collier (vgl. Medien-Offensive des Agrobusiness [1]) – die Rücknahme von Subventionen (z.B. für Agrotreibstoffe) in einer bürgerlichen Demokratie als unrealistisch. »The likelihood of a substantial reduction in U.S. corn-based ethanol subsidies is unlikely. Once democratic governments begin to subsidize something, withdrawing the subsidy...
Lesezeit: 3 MinutenBeiträge bleiben aus
Welternährungsprogramm in Finanznöten: UN-Unterstützungsfonds fehlen drei Milliarden Dollar – knapp die Hälfte seines Budgets. Hilfe für Hunderttausende Hungernde eingestellt Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (World Food Program – WFP) muß wegen fehlender finanzieller Mittel seine Hilfslieferungen einschränken. Bis zum Jahresende rechnet die UN-Organisation mit einem Fehlbetrag von drei Milliarden Dollar. Dies geht aus einem im vergangenen Monat veröffentlichten Bericht hervor. Bereits Ende Juni hatte der Leiter des Berliner WFP-Büros, Ralf Südhoff, offenbart, seine Organisation habe erst 25 Prozent ihres Budgets für 2009 erhalten. Das WFP ist zu hundert Prozent auf freiwillige Beiträge, in erster Linie von Regierungen, angewiesen. Für die Unterstützung von 108 Millionen bedürftigen Menschen in 74 Ländern hatte das WFP einen Finanzbedarf von 6,7 Milliarden Dollar errechnet. Angesichts der nach wie vor unvollständigen Deckung des Budgets hat sich das Welternährungsprogramm nun zu drastischen Kürzungen entschlossen. So muß im Laufe des August der humanitäre Flugdienst des WFP in Teilen Afrikas eingestellt werden, mit dem sowohl Helfer als auch ein...
Lesezeit: 4 Minuten