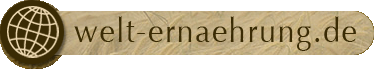Gastbeitrag: Grüner Landraub durch Naturschutz
von Rene Vesper Hausarbeit bei Prof. K.-H. Erdmann, Geografisches Institut, Universität Bonn. Die Arbeit kann HIER herunter geladen werden. Nachstehend ein Auszug aus der Einleitung: Im 21. Jahrhundert blickt der globale Norden mit Demut auf die vergangenen zwei Jahrhunderte zurück, in denen im Zuge der Industrialisierung und Globalisierung die Ressourcen des Planeten in großem Stile ausgebeutet wurden. Während das Wissen um das Ausmaß globaler Umweltzerstörung zunimmt, wird der Ruf nach mehr Umweltschutz in der Öffentlichkeit lauter. Auch die weltweit größten Umweltschutz-Nichtregierungsorganisationen (NGOs) haben sich unlängst grüne Agenden auf die Fahnen geschrieben. Durch ein hohes Spendengeldaufkommen, eigene Umweltfonds, Umweltschutzprojekte und eigene Zertifikatsysteme haben sie einen großen Einfluss in Umweltdiskursen erlangt. Ihre Position im internationalen Umweltregime ist jedoch umstritten, da es in einigen ihrer Projekte zu gewaltvollen Vertreibungen und anderen Menschenrechtverletzungen kam (Schmidt-Soltau 2005, 284-285, In: Pedersen 2008, 32; CLA & VEG 2015). Da unlängst auch eine große Bandbreite von VertreterInnen aus der Industrie mit umweltfreundlichen Werbespots, Slogans und CSR-Umweltprojekten4 aufwarteten, stellt...
Lesezeit: 2 MinutenTagung im Mai: In neuen Territorien denken – statt Ausverkauf von Land
6. – 8. Mai 2016 Evangelische Akademie Bad Boll In neuen Territorien denken – statt Ausverkauf von Land Weltweit nimmt die Landkonzentration zu, während umverteilende Landreformen aus der Mode gekommen sind. Die Konsequenzen sind in unterschiedlicher Form überall spürbar: neue Abhängigkeiten, sinkender Handlungsspielraum und eingeschränktes Entwicklungspotential nicht nur für Bäuerinnen und Bauern, Akteure im ländlichen Raum, sondern für die breite Bevölkerung. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der weltweiten Entwicklungen wollen wir unter anderem mit Saturnino Borras (Den Haag), Caroline Callenius (Stuttgart), Nadja Charaby (Berlin), Kerstin Lanje (Aachen), Wolfgang Hees (Eichstetten), Angela Müller (Niederstetten) Luis Hernández Navarro (Mexiko), Uwe Hoering (Bonn), Stefan Ofteringer (Aachen), Victor Rodrigues (Portugal), Adriano Talles Reis (Brasilien) und Philian Zamchiya (Zimbabwe) diskutieren. Wo findet Landkonzentration statt? Welche Konsequenzen hat dies? Wie beeinflussen internationale Entscheidungen die regionalen Entwicklungen? Welche Zwänge und Dynamiken bestimmen Prozesse der Landkonzentration? Wo kann gegengesteuert werden? Können Agrarreformprojekte gesellschaftliche Veränderungen anstoßen und so für mehr Verteilungsgerechtigkeit und weniger Armut sorgen? Unter welchen Bedingungen ist dies...
Lesezeit: < 1 MinuteLandgrabbing
Auf den 5. Heppenheimer Tagen zur christlichen Gesellschaftsethik ging es um Fragen des Bodeneigentums aus unterschiedlichsten Perspektiven Thesen zum Thema Landgrabbing von Peter Clausing 1. Einerseits wird die Verabschiedung der freiwilligen Leitlinien der FAO (Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security) im Jahr 2012 als großer Erfolg betrachtet, auch deshalb, weil diese Leitlinien sehr bald nach dem kritisierten Weltbankbericht zum Thema Landgrabbing (Deininger und Byerlee 2011) verabschiedet wurde. Andererseits kann Landgrabbing nicht losgelöst von anderen Politikfeldern betrachtet werden, die das Landgrabbing bedingen bzw. beeinflussen oder selbst vom Landgrabbing beeinflusst werden. Dazu gehören u.a.: – Handelspolitik allgemein, insbesondere aber die Liberalisierung von Börsengeschäften mit Nahrungsmitteln (Spekulation); – Politik bezüglich Ernährungsgewohnheiten (Fleischkonsum, Vergeudung von Lebensmitteln, Dumpingpreise); – Klima-, Energie- und Biodiversitätspolitik (Agrotreibstoffe, Landnutzungsänderungen, Schutzgebiete); – Förderung bestimmter Modelle landwirtschaftlicher Produktion (ungenügende bzw. nur Alibi-mäßige Förderung von Alternativen zu input-intensiver, profit-orientierter Landwirtschaft); – Migrationspolitik; – Informationspolitik (Beispiel: das Fehlen ökonomischer Hintergrundinformationen, inklusive...
Lesezeit: 10 MinutenLandungerechtigkeit: Hunger und Migration
Der chronische Nahrungsmangel im subsaharischen Afrika hängt mit der Ungleichheit im Besitz von Grund und Boden zusammen. Eine Abwanderung in die Städte lindert die Not in der Regel nicht. Von Peter Clausing In den Ländern südlich der Sahara, dem sogenannten subsaharische Afrika, leben über 200 Millionen chronisch hungernde Menschen – das sind etwa 30 Prozent der dortigen Bevölkerung. Davon sind vor allem die auf dem Land lebenden Menschen betroffen, für die »chronischer Hunger« zumeist bedeutet, dass er alljährlich wiederkehrt, nämlich dann, wenn die eigenen Vorräte zur Neige gehen und das Geld nicht reicht, um zusätzliche Lebensmittel zu kaufen. Diese Periode kann mehrere Wochen bis mehrere Monate dauern – je nachdem wie die vorherige Ernte ausfiel. Typisch ist das für Betriebe, bei denen die landwirtschaftlich bearbeitete Fläche unter einer Größe von zwei Hektar liegt. 80 Prozent der afrikanischen Bäuerinnen und Bauern bewirtschaften derart kleine Flächen und ernähren damit mehr schlecht als recht eine oftmals sechs- bis achtköpfige Familie. In Malawi zum...
Lesezeit: 9 MinutenGastbeitrag: Die Metamorphose der Raubbaukonzerne
von Peter Gerhardt Es klingt ein bisschen wie im Märchen. Multinationale Konzerne zerstören Wälder und treten Menschenrechte mit Füßen. Durch das Engagement internationaler Umweltschutzorganisationen werden diese in wenigen Monaten dann zu verantwortungsvollen Unternehmen. Palmöl- und Papiermultis wie Wilmar, Golden Agri, APRIL (Asia Pacific Resources International Limited) oder APP (Asia Pulp and Paper) haben diese wundersame Metamorphose vom Kahlschlag-Konzern zum Regenwaldschützer in Indonesien bereits durchlaufen. All diese Firmen haben jetzt eine „Zero-Deforestation-Policy“. Parallel dazu haben Konsumgüterriesen wie Nestle, Unilever, Mars, L’Oreal, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive, die Palmöl als Rohstoff benötigen, ähnliche Versprechen abgegeben. Greenpeace WWF und Co. scheint zu gelingen, woran indonesische Umweltgruppen sich seit Jahren die Zähne ausbeißen: Notorische Regenwaldzerstörer zur Besserung zu bewegen. Die Drehbücher für diese Geschichten gleichen sich. Zunächst wird ein großer Konzern mit einer aufwändigen Kampagne in Nordamerika oder Europa an den Verhandlungstisch gezwungen. Dort wird zäh gerungen, aber fast immer kommt es zum Happy End: Der Konzern gelobt öffentlich Besserung und die an der...
Lesezeit: 4 MinutenNaturschutz als Landraub – Betrachtungen zum Tag der Menschenrechte
Nationalparks bewahren die biologische Vielfalt. Gleichzeitig aber werden die dort lebenden Menschen verdrängt und ihrer Existenzgrundlage beraubt. Von Peter Clausing Am 10. Dezember wird alljährlich der Tag der Menschenrechte begangen. 1948 wurde an diesem Datum die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. Nicht selten wird an diesem Tag vorrangig über die bürgerlichen und politischen Menschenrechte öffentlich nachgedacht, zu denen das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht auf Versammlungsfreiheit und das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit zählen. Es ist auch der Todestag Alfred Nobels, der 1894, zwei Jahre vor seinem Ableben, den schwedischen Rüstungsbetrieb Bofors kaufte. Nichtsdestotrotz wird seit 1901 am 10. Dezember der Friedensnobelpreis vergeben. Neben den bürgerlichen und politischen Menschenrechten sind die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen (WSK-) Rechte ein anderer, ebenso wichtige Teil von Menschenrechten. Für beide Gruppen trat im Jahr 1976 jeweils ein internationaler Pakt in Kraft, in dem die betreffenden Rechte verbindlich beschrieben sind. Zu den WSK-Rechten zählt das im Artikel...
Lesezeit: 10 MinutenNeue DVD: Über den Tellerrand – Ernährungssouveränität in Zeiten des Klimawandels
“Ernährungssouveränität” ist die zentrale Forderung der kleinbäuerlichen Bewegungen in Bangladesch. Angesichts von Klimawandel, Flächenknappheit und Landkonflikten setzen sie sich für eine gerechte Landverteilung und eine selbstbestimmte Agrarproduktion ein. Eigene Parzellen sowie kulturell und ökologisch angepasstes Saatgut sehen sie als Basis für die Nahrungsmittelversorgung. Die Bewegungen verfolgen ihre Ziele gegebenenfalls mit radikalen Mitteln: Sie besetzen und bewirtschaften Land, das ihnen laut Gesetz zusteht, aber aufgrund von Korruption nicht übertragen wird. Der Anbau für den Eigenbedarf und die lokalen Märkte wird durch die Kapitalisierung des Agrarsektors stark gefährdet. Seit der “Grünen Revolution” in den 1960er Jahren nimmt der Einfluss von Saatgut- und Chemiekonzernen beständig zu. Die Abhängigkeit von Dünger, Pestiziden und modifizierten Samen sowie die infrastrukturellen Eingriffe durch Staat und Weltbank haben die Lebensbedingungen der Kleinbäuerinnen und -bauern verändert. Höhere Produktionskosten und sinkende Bodenfruchtbarkeit sind die Schattenseiten der gesteigerten Ernten, die viele in die Verschuldung treibt. Heute gelten drei viertel aller Bangladeschis offiziell als landlos und haben laut “Kash-Land-Gesetz” Anspruch auf eigene...
Lesezeit: 2 MinutenLand Control Grabbing: Besitz ist gut, Kontrolle ist besser
Obwohl Mexiko für das klassische Land Grabbing ein untypischer Fall ist, spielt das Phänomen eine durchaus beachtliche Rolle, wenn man den Blickwinkel erweitert und Land Control Grabbing einbezieht. Bei einer solchen Erweiterung des Blickwinkels wird deutlich, dass auf diese Weise in Mexiko inzwischen 30% der landwirtschaftlichen Nutzfläche durch Dritte kontrolliert werden. Näheres dazu in einem Beitrag in der ILA. Umgekehrt gibt es zaghafte Versuche von Regierungen bestimmter Länder, Land Grabbing durch gesetzlich Regelungen bzw. Moratorien einzudämmen. Daran knüpft sich die Frage an, ob sich bäuerliches Wirtschaften und agrarökologische Methoden wie die Push-Pull-Technologie, die im subsaharischen Afrika 300 Millionen Menschen zugutekommen könnte, gegen die mit dem Landraub verbundene Großflächenproduktion behaupten können. Siehe dazu den Beitrag in Oekologie und Landbau.
Lesezeit: < 1 MinuteHunger und Verwüstung
Lebensmittelspekulation, Land Grabbing und Agrotreibstoffproduktion: Drei aktuelle Instrumente zur Renditemaximierung verursachen Nahrungsmangel und Verödung von Böden von Peter Clausing Die DWS Investments, eine Fondsgesellschaft der Deutschen Bank, frohlockte vor einiger Zeit auf ihrer Website: »Die rasant wachsende Weltbevölkerung, (…) Land- und Wasserknappheit – all das sind Punkte, die für überdurchschnittlich gute Perspektiven der Agrarwirtschaft sprechen.« Derlei Sprüche sind in der Welt der Investmentbanker inzwischen häufig zu finden. Die Fondsmanager bieten den Investoren sogenannte Alpha-Renditen von bis zu 25 Prozent jährlich. Die Angst vor »Brotrevolten« (Food Riots), die in den Jahren 2007/2008 die Welt erschütterten, scheint verflogen. Damals, als sich die Preise für Reis, Mais und andere Getreidearten innerhalb von ein, zwei Jahren verdoppelten oder gar verdreifachten, gab es Hungerproteste in über 40 Ländern.1 Im Jahr 2009 reduzierten sich die Weltmarktpreise für Nahrungsmittel auf das Durchschnittsniveau von 2007, aber seit 2011 liegen sie sogar über dem Wert von 2008. Doch wo bleiben die Proteste? In etlichen Ländern, die vor knapp fünf...
Lesezeit: 9 MinutenGlobales Land Grabbing: die europäische Dimension
von Peter Clausing Die vier wesentlichen Triebkräfte, die den Kauf und die Pacht riesiger Flächen in den Ländern des Südens und Osteuropas befeuern – Nahrungsmittelspekulation, der Einsatz von Agrotreibstoffen, die Suche nach “sicheren“ Anlagen sowie Ernteausfälle aufgrund von Klimawandel und Bodenmüdigkeit – haben sich seit dem vor drei Jahren an dieser Stelle veröffentlichten Beitrag nicht geändert.(1) Allerdings haben sich bei den investierenden Interessengruppen die Proportionen verschoben: Waren es ursprünglich vor allem Länder mit prekärer Eigenversorgung, die auf der Suche nach mehr Unabhängigkeit von den Fluktuationen der Weltmarktpreise nach Möglichkeiten eines Offshore farming suchten, sind es heute in viel stärkerem Maße Investoren, die auf Steigerungen bei den Lebensmittel- und Bodenpreisen spekulieren. Hinzu kommt noch die Rolle der Europäischen Union und die der EU-„Bio“kraftstofflobby, wie im Folgenden gezeigt wird. Die Europäische Union und die „Bio“kraftstofflobby Bei Ländern mit prekärer Eigenversorgung denkt man zunächst an China, Südkorea und die Golfstaaten. Doch wenn es um Eigenversorgung durch importierte Waren geht, rückt Europa auf einen...
Lesezeit: 6 Minuten