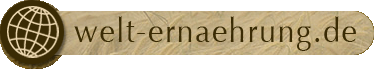Der Ukraine-Krieg und die Welternährungskrise
Zwölf Tage nach Beginn des Krieges, am 08. März, publizierte die Welternährungsorganisation (FAO) eine 40-seitige Analyse, die sich mit den Risiken befasste, die aus dem Ukraine-Krieg für die globale Lebensmittelversorgung ergeben könnten und gab einen düsteren Ausblick. Ausgangspunkt der Überlegungen war der Umstand, dass in den Jahren zuvor aus Russland und der Ukraine zusammengenommen 30 Prozent der globalen Weizenexporte und über Hälfte der Exporte von Sonnenblumenkernen bzw. -öl kamen, außerdem Mais und Gerste. Hinzu kommt, dass die Russische Föderation Platz 1 beim Export von Stickstoffdüngern und Platz 2 beim Export von Phosphor- und Kalidünger einnimmt. Bezogen auf die globale Exportmenge lag der Anteil Russlands laut FAO-Statistik in den letzten Jahren für alle drei Pflanzennährstoffen grob gerechnet jeweils zwischen 10 und 15 Prozent. In 25 Ländern betrug der Anteil aus Russland importierter Düngemittel bei 30 Prozent und mehr. Die Synthese von Stickstoffdünger erfolgt fast ausnahmslos unter Verwendung von Gas in einem extrem energieintensiven Prozess, dem Haber-Bosch-Verfahren. Die hohen Gaspreise schlugen sich...
Lesezeit: 8 MinutenBaumrinden-Monitoring der Pestizid-Belastung über die Luft: Eine toxikologische Bewertung
Der volle Bericht dieser für das „Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft e.V.“ erstellten Analyse befindet sich hier Hier die Zusammenfassung: In einer 2019 veröffentlichten Studie zu einem bundesweiten Monitoring der Immissionsbelastung der Luft durch Pestizide wurden insgesamt 104 verschiedene Pestizide nachgewiesen. Im vorliegenden Bericht werden 15 der am häufigsten nachgewiesenen Wirkstoffe näher betrachtet: Boscalid, Clomazon, Diflufenican, Epoxiconazol, Ethofumesat, Flufenacet, Glyphosat, Metalaxyl, Metazachlor, Pendimethalin, Prosulfocarb, Prothioconazol, S-Metolachlor, Tebuconazol, Terbuthylazin. Hervorzuheben ist, dass 13 von 14 Wirkstoffen (für den 15. Wirkstoff war kein adäquater Wert für den Dampfdruck vorhanden) offiziell als nicht flüchtig einzustufen sind, wenn man die Kriterien der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA 2014) zugrunde legt, d.h. ihr Dampfdruck beträgt weniger als 5 x 10-3, gemessen bei 25 °C (Tabelle 3). Während Clomazon als einziger Wirkstoff einen Wert oberhalb dieser Grenze aufweist, wurden beim Baumrindenmonitoring 11 Wirkstoffe mit „schwacher Flüchtigkeit“ an Standorten nachgewiesen, die sich in mittlerer (mehrere hundert Meter) bis weiter Entfernung (über 1 km) von landwirtschaftlichen Nutzflächen befanden...
Lesezeit: 2 MinutenTagungsankündigung: Deutsche Unternehmen im Globalen Süden – Umwelt- und Menschenrechtsvergehen
Rüstungsexporte – Automobilindustrie – Pestizidexporte Tagung und Vernetzungstreffen Fr. 13. Januar 2017: 14:00 – 18:30 Sa. 14. Januar 2017: 10:00 – 16:15 Die Tagung soll Aktivist_innen, Wissenschaftler_innen, interessierten Personen, Student_innen einerseits einen Überblick zu bestimmten Aspekten dieses Rahmenthemas bieten und andererseits die Möglichkeit zur Vernetzung geben. Auf der Konferenz sollen die Bereiche Rüstungsexporte, Pestizidexporte und die Strategien der Autoindustrie unter folgender Fragestellung untersucht werden: Welche Rolle spielen deutsche Firmen und deutsche Exporte im globalen Süden? Ein Fokus wird dabei auf Menschenrechtsverletzungen durch deutsche Unternehmen in Mexiko liegen, jedoch werden auch weitere Länder des globalen Südens wie die Philippinen, Indien, Argentinien und Brasilien einbezogen. Aktivist_innen, Expert_innen und Interessierte sollen ihr „natürliches Umfeld“ verlassen und im Dialog neue Fragen aufwerfen, sich über ihre verschiedenen Aktionsformen sowie Falluntersuchungen austauschen. Dadurch soll ein wenig Licht in das Dunkel geworfen werden, in dem deutsche Unternehmen im globalen Süden operieren. Anmeldungen unter: thorsten.schulz@fdcl.org Das Programm hier zum Download
Lesezeit: < 1 MinutePhosphor: Fluch und Segen eines Elements
von Peter Clausing Der europäische Phosphorzyklus könnte vollständig geschlossen werden, wenn die importierten chemischen Phosphatdünger komplett gegen biologische und recyclte chemische Phosphordünger ersetzt würden. Damit stiege die Wasserqualität in Europa und viele andere Probleme wären gelöst. Doch um das zu erreichen, müsste das Diktat der »Marktkräfte« überwunden werden. Phosphor ist ein lebensnotwendiges chemisches Element. Sowohl im menschlichen Körper als auch in Pflanzen beträgt sein Anteil zwar nur zirka ein Prozent. Ohne Phosphor gäbe es aber kein Leben in seiner jetzigen Form. Er ist Baustein der Erbinformation DNS, von Proteinen und Enzymen. Die Freisetzung und Speicherung von Energie in den Zellen von Tieren und Pflanzen erfolgt unter obligatorischer Beteiligung von Phosphor. Im Pflanzenbau ist Phosphor unverzichtbar und kann durch nichts ersetzt werden. Daraus folgt, dass eine Landwirtschaft, die nicht auf geschlossenen Kreisläufen basiert, letztlich auf Phosphorzufuhr von außen angewiesen ist. Nach Verarbeitung des Rohphosphats wird der Phosphor in pflanzenverfügbarer Form in den Boden eingebracht, zumeist als Diphosphat, das wenig wasserlöslich ist,...
Lesezeit: 9 Minuten„Sauerei!“ – Bauer Willis misslungene Demagogie (Rezension)
von Peter Clausing „Sauerei!“ hätte ein gutes Buch werden können. Es ist flüssig geschrieben, wenngleich etwas distanzlos-kumpelhaft, aber das trifft sicher den Nerv vieler Leserinnen und Leser. Und der Verfasser ist ein echter Insider. Kremer-Schillings bewirtschaftet 50 Hektar, den gleichen Hof wie sein Vater und sein Großvater. Er schöpft aus dem Vollen, was die Beschreibung des Lebens eines Landwirts anbetrifft – und das über drei Generationen. Aber „Sauerei“ ist im besten Fall ein ärgerliches Buch, eher aber ein gefährliches, wenn man dem Aphorismus von Georg Christoph Lichtenberg folgt, der schon im 18. Jahrhundert erkannte: „Das Gefährliche sind nicht die dicken Lügen, sondern Wahrheiten, mäßig entstellt.“ Das Buch charakterisiert detailreich die Krise der deutschen und europäischen Landwirtschaft, um dann den Popanz des „Verbrauchers“ aufzubauen, der an der Misere des Landwirts schuld sei und in dessen Macht es läge, daran etwas zu ändern. Das soll uns nicht von verantwortungsvollem Verbrauch freisprechen. Doch damit allein wird das Problem nicht gelöst. Es ist nicht...
Lesezeit: 3 MinutenZur Fehlbewertung von Glyphosat durch Behörden und Industrie
Am 2.März 2016 wurde gegen das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), die in Parma, Italien, ansässige Europäische Lebensmittelbehörde (EFSA) und gegen die belgische Niederlassung von Monsanto, von der im Namen der „Glyphosate Task Force“ die Wiedergenehmigung des Pestizidwirkstoffs Glyphosat beantragt wurde, Strafanzeige erstattet. In einem Anhang zu dieser Anzeige wurde die fachliche Begründung für die in der Strafanzeige geäußerte Anschuldigung geliefert, dass Behörden und Industrie mit falschen Angaben versuchen, die Wiedergenehmigung von Glyphosat zu erreichen, obwohl dieses von der Krebsagentur der Weltgesundheitsorganisation (IARC) als „wahrscheinlich krebserregend beim Menschen“ eingestuft wurde.
Lesezeit: < 1 MinuteProfitables Ackergift
von Peter Clausing Das Verhältnis zwischen agrochemischer Industrie, landwirtschaftlichen Produzenten und Verbrauchern wirft nicht nur ein Schlaglicht auf den Zustand unserer Landwirtschaft, sondern auch auf den unserer Demokratie. Das lässt sich anhand des Streits um die weitere Genehmigung des Wirkstoffs Glyphosat, auch Bestandteil des Breitband-Unkrautvernichtungsmittels »Roundup«, zeigen, von dem bereits vor fünf Jahren bei einem Jahresumsatz von knapp 4 Milliarden US-Dollar etwa 610.000 Tonnen weltweit eingesetzt wurden. Eigentlich liegt es auf der Hand: Ökologischer Landbau ist klimafreundlicher und umweltverträglicher als die konventionelle Landwirtschaft. Eventuelle Mindererträge durch eine Umstellung auf ökologischen Landbau sind – je nach Kultur und Anbauverhältnissen – entweder überschaubar oder gar nicht vorhanden.1 Allerdings ist der Arbeitsaufwand im ökologischen Landbau in der Regel höher, was die Produktion verteuert. Doch angesichts von landwirtschaftlicher Überproduktion, Niedrigpreisen für konventionell produzierte Lebensmittel und der Tatsache, dass rund ein Drittel davon im Müll landet, fragt man sich, warum unsere Landwirtschaft nicht schon längst komplett auf Ökolandbau umgestellt wurde. Der macht derzeit statt dessen...
Lesezeit: 8 MinutenGlyphosat-Krebsstudien an Mäusen – Argumente der EU-Behörde ohne Grundlage
Von Peter Clausing Am 12. November veröffentlichte die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit (EFSA) ihre Schlussfolgerung zur Bewertung des Herbizidwirkstoffs Glyphosat, der von der WHO-Agentur für Krebsforschung (IARC) als „wahrscheinlich krebserregend beim Menschen“ eingestuft wurde, was eine weitere Genehmigung dieses Wirkstoffs in Europa mit größter Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen hätte, wenn die EFSA sich dieser wissenschaftlich fundierten Bewertung angeschlossen hätte – hat sie aber nicht. Anfang Dezember 2015 wurde der entscheidende Teil der EFSA-Schlussfolgerungen, jene zu den Krebsstudien an Labormäusen, einer kritische Analyse unterzogen. Zu diesem 10-seitigen englischsprachigen Dokument gibt es jetzt die nachstehende deutsche Zusammenfassung. In allen fünf validen Krebsstudien an Mäusen wurde bei Anwendung des von der OECD empfohlenen Cochran-Armitage-Trend Tests eine signifikante Erhöhung der Tumorrate bei einem oder mehreren Tumortypen festgestellt, womit das Kriterium „ausreichende Nachweise beim Tier“, der CLP-Verordnung (1272/2008, Annex I; 3.6.2.2.3) erfüllt ist. Die EFSA bestreitet dies mit folgenden Argumenten: Fehlende statistische Signifikanz bei Anwendung paarweiser Vergleiche Diese Behauptung entbehrt der Grundlage. Die OECD empfiehlt seit 2012...
Lesezeit: 2 MinutenPrivate Stiftungen – Speerspitze der globalen Agrarkonzerne?
Von Peter Clausing Die „neuen Philanthropen“, wie sich die Milliardäre des 21. Jahrhunderts nennen, schaffen mit ihren Stiftungen unter Umgehung demokratischer Entscheidungsprozesse die Voraussetzungen für die Ausdehnung der Märkte transnationaler Konzerne. Verbrämt durch einen Diskurs der Armutsbekämpfung, fördern sie die Entstehung einer neuen agrarischen Mittelschicht im subsaharischen Afrika, die ausreichend zahlungskräftig ist, um sich die Segnungen einer neuen Grünen Revolution leisten zu können. Mangel an Demokratie ist eine wesentliche Voraussetzung dafür. Zwar behauptet die Grüne Revolution 2.0, dass sie die afrikanischen KleinbäuerInnen aus der Armutsfalle ziehen wolle, doch gerade diese profitieren nicht davon! Die eigentlichen Nutznießer des neuen landwirtschaftlichen Booms sind – wie Untersuchungen in Kenia und Sambia zeigen – reiche Städter, in der Mehrzahl Regierungsangestellte, die sich in die Landwirtschaft einkaufen. Das erste Anzeichen für eine neue „Grüne Revolution“ gab es 1997, als Gordon Conway, der kurz darauf zum Präsidenten der Rockefeller-Stiftung ernannt wurde, sein Buch „The Doubly Green Revolution: Food for All in the Twenty-first Century”, veröffentlichte (1)....
Lesezeit: 14 MinutenLandgrabbing
Auf den 5. Heppenheimer Tagen zur christlichen Gesellschaftsethik ging es um Fragen des Bodeneigentums aus unterschiedlichsten Perspektiven Thesen zum Thema Landgrabbing von Peter Clausing 1. Einerseits wird die Verabschiedung der freiwilligen Leitlinien der FAO (Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security) im Jahr 2012 als großer Erfolg betrachtet, auch deshalb, weil diese Leitlinien sehr bald nach dem kritisierten Weltbankbericht zum Thema Landgrabbing (Deininger und Byerlee 2011) verabschiedet wurde. Andererseits kann Landgrabbing nicht losgelöst von anderen Politikfeldern betrachtet werden, die das Landgrabbing bedingen bzw. beeinflussen oder selbst vom Landgrabbing beeinflusst werden. Dazu gehören u.a.: – Handelspolitik allgemein, insbesondere aber die Liberalisierung von Börsengeschäften mit Nahrungsmitteln (Spekulation); – Politik bezüglich Ernährungsgewohnheiten (Fleischkonsum, Vergeudung von Lebensmitteln, Dumpingpreise); – Klima-, Energie- und Biodiversitätspolitik (Agrotreibstoffe, Landnutzungsänderungen, Schutzgebiete); – Förderung bestimmter Modelle landwirtschaftlicher Produktion (ungenügende bzw. nur Alibi-mäßige Förderung von Alternativen zu input-intensiver, profit-orientierter Landwirtschaft); – Migrationspolitik; – Informationspolitik (Beispiel: das Fehlen ökonomischer Hintergrundinformationen, inklusive...
Lesezeit: 10 Minuten