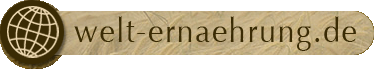Endlich Licht ins Dunkel bringen – ein Interview zum Thema Pestizidzulassung
Sind die aktuellen Pestizidverordnungen reine Makulatur? Nach Ansicht des Toxikologen Peter Clausing krankt der Umgang der EU mit Pestiziden an strukturellen und methodischen Mängeln. Yussefi-Menzler, Redakteurin der Zeitschrift Ökologie und Landbau, hat ihn gefragt, wo genau die Probleme liegen und wie Zulassungsverfahren in die richtigen Bahnen gelenkt werden können. Der Artikel kann hier heruntergeladen werden.
Lesezeit: < 1 MinuteAgrarökologie – Definitionen, Kontext und Potenziale
von Peter Clausing – ursprünglich veröffentlicht auf globe-spotting.de im November 2015 – Vor einigen Jahren wurde Agrarökologie als „Wissenschaft, Bewegung und Praxis“ definiert (Wezel et al. 2009). Das bringt zum Ausdruck, dass das Konzept weitaus mehr beinhaltet als das, was in unseren Breiten landläufig hinter dem Begriff „Bio-…. “ gesehen wird. Die Bezugnahme auf „Bewegung“ bedeutet allerdings nicht, dass Agrarökologie automatisch mit gesellschaftlichem Umbruch und der Entstehung einer gerechteren Gesellschaftsordnung gleichzusetzen ist. Doch sicherlich ist sie ein ‚Trittstein’ auf dem Weg dorthin. Die ‚Scharnierfunktion’ der Agrarökologie zwischen Natur- und Gesellschaftswissenschaft existierte nicht von Anbeginn. Als der Begriff 1928 von dem sowjetischen Agronomen B.M. Bensin geprägt wurde, war damit ausschließlich Biologisches gemeint – das Zusammenleben von Organismen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen. Auch in der Tradition des Kieler Professors Wolfgang Tischler, der 1965 als erster ein Handbuch mit dem Titel Agrarökologie veröffentlichte, wird das Gebiet vornehmlich als biologisches Fach verstanden. Doch die Zeiten haben sich geändert. Francis et al (2003, 100) definierten diese...
Lesezeit: 6 MinutenIntensiv und ineffizient
Die industrielle Landwirtschaft ist an den Verbrauch fossiler Brennstoffe gekoppelt. Die Energiebilanz ihrer Produkte ist negativ. Von Peter Clausing Alljährlich am 17. April hat die globale Kleinbauernorganisation La Via-Campsina ihren Aktionstag. Die Organisation sagt, daß Kleinbauern energieeffizienter produzieren als Großbetriebe. Seit Jahrtausenden besteht der Sinn des Ackerbaus in der Umwandlung von Sonnenenergie in »essbare«. Das geschieht mit Hilfe der Photosynthese, deren Effizienz zwar gering ist, denn jener Anteil der eingestrahlten Sonnenenergie, der in Biomasse umgewandelt wird, beträgt weniger als zwei Prozent. Trotzdem wird über das Jahr und die Fläche verteilt in Früchten und Knollen genügend Energie akkumuliert, um die Weltbevölkerung zu versorgen. Die Sonnenstrahlung steht gratis zur Verfügung. Der Anteil an Energie, der darüber hinaus in die Erzeugung und Verarbeitung von Nahrung gesteckt wurde, war für lange Zeit von geringer Bedeutung. Diese Situation hat sich in den vergangenen hundert Jahren dramatisch geändert. Zwar wurden in den letzten Jahrzehnten in vielen Teilen der Welt die Hektarerträge erheblich gesteigert. Erkauft wurde dieser...
Lesezeit: 10 MinutenNeue DVD: Über den Tellerrand – Ernährungssouveränität in Zeiten des Klimawandels
“Ernährungssouveränität” ist die zentrale Forderung der kleinbäuerlichen Bewegungen in Bangladesch. Angesichts von Klimawandel, Flächenknappheit und Landkonflikten setzen sie sich für eine gerechte Landverteilung und eine selbstbestimmte Agrarproduktion ein. Eigene Parzellen sowie kulturell und ökologisch angepasstes Saatgut sehen sie als Basis für die Nahrungsmittelversorgung. Die Bewegungen verfolgen ihre Ziele gegebenenfalls mit radikalen Mitteln: Sie besetzen und bewirtschaften Land, das ihnen laut Gesetz zusteht, aber aufgrund von Korruption nicht übertragen wird. Der Anbau für den Eigenbedarf und die lokalen Märkte wird durch die Kapitalisierung des Agrarsektors stark gefährdet. Seit der “Grünen Revolution” in den 1960er Jahren nimmt der Einfluss von Saatgut- und Chemiekonzernen beständig zu. Die Abhängigkeit von Dünger, Pestiziden und modifizierten Samen sowie die infrastrukturellen Eingriffe durch Staat und Weltbank haben die Lebensbedingungen der Kleinbäuerinnen und -bauern verändert. Höhere Produktionskosten und sinkende Bodenfruchtbarkeit sind die Schattenseiten der gesteigerten Ernten, die viele in die Verschuldung treibt. Heute gelten drei viertel aller Bangladeschis offiziell als landlos und haben laut “Kash-Land-Gesetz” Anspruch auf eigene...
Lesezeit: 2 MinutenKleinbauern leisten Widerstand
La Vía Campesina ist in diesem Jahr 20 Jahre alt geworden Von Peter Clausing In der mit Tränengas gesättigten Luft von Seattle im Dezember 1999 dankten die Frauen von Vía Campesina der Welthandelsorganisation (WTO): Die Repressionsmaßnahmen während des WTO-Gipfels hätten die zahlreich zu den Protesten erschienenen KleinbäuerInnen zusammengeschmiedet. Auch wurde die globale Föderation widerständiger LandwirtInnen erst durch die Massenproteste und die Polizeigewalt gegen AktivistInnen in Seattle weltweit sichtbar, obwohl Vía Campesina schon sechs Jahre zuvor gegründet worden war. Damals hatten Indigene und LandarbeiterInnen den Paradigmenwechsel erkannt, den Anfang der 1990er Jahre die Aufnahme landwirtschaftlicher Themen in die Verhandlungen des GATT-Abkommens (General Agreement on Tariffs and Trade) bedeutete. 1993 trafen sich daher 46 von ihnen im belgischen Mons und gründeten einen gemeinsamen Dachverband. Die im GATT-Abkommen getroffenen Vereinbarungen legten den Grundstein für die marktbasierte Zerstörung jener agrarpolitischen Strukturen und Programme, die die BäuerInnen in den Jahren zuvor in verschiedenen Ländern erkämpft hatten. Vía Campesina propagierte schon damals eine Landwirtschaft, die ökologisch...
Lesezeit: 3 MinutenRecht auf Nahrung
In diesen Tagen erscheint das Buch »Die grüne Matrix. Naturschutz und Welternährung am Scheideweg.« Die Tageszeitung junge Welt veröffentlichte eine unter Weglassung von Fußnoten und Literaturhinweisen gekürzte Fassung des Abschnitts »Agrarökologie – Definitionen, Kontext und Potentiale«. Von Peter Clausing Die »Scharnierfunktion« der Agrarökologie zwischen Natur- und Gesellschaftswissenschaft existierte nicht von Anbeginn. Als der Begriff im Jahr 1928 von dem sowjetischen Agronomen B.M. Bensin geprägt wurde, war damit ausschließlich Biologisches gemeint – das Zusammenleben von Organismen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen. Auch in der Tradition des Kieler Professors Wolfgang Tischler, der 1965 als erster ein Handbuch mit dem Titel Agrarökologie veröffentlichte, wird das Gebiet vornehmlich als biologisches Fach verstanden. Im Gegensatz dazu definierten Charles Francis und andere 2003 diese Wissenschaftsdisziplin als »integrative Erforschung der Ökologie des gesamten Nahrungsmittelsystems, einschließlich seiner ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimensionen«. Auch Thomas Dalgaard und seine Kollegen kommen 2003 zu der Schlussfolgerung, dass es sich bei Agrarökologie um die Integration agronomischer, ökologischer, soziologischer und ökonomischer Forschung handelt. Bäuerliche Interessen...
Lesezeit: 9 MinutenBill Gates in Afrika
Diesen Beitrag gibt es auch auf Französisch und Spanisch Seit 2006 bemüht sich, relativ wenig beachtet, die „Allianz für eine Grüne Revolution in Afrika“, den profitablen Teil der afrikanischen Landwirtschaft in den Weltmarkt zu integrieren. Hinzu kommt, dass parallel dazu, ebenfalls in Afrika, seit 2010 versucht wird, eine wichtige Komponente agrarökologischer Anbauverfahren unter private Kontrolle zu bringen – die biologische Anreicherung von Stickstoff im Boden. Wiederum gehört die Bill & Melinda Gates-Stiftung zu den Hauptakteuren. Von Peter Clausing TEIL I Zugegeben, Revolutionen sind aus der Mode gekommen. Dabei wäre eine grüne Revolution, die diesen Namen tatsächlich verdient, in Afrika bitter nötig. Denn einerseits ist für 200 Millionen der dort lebenden Menschen Hunger eine täglich Realität, andererseits ist das Potential vorhanden, Afrikas Bevölkerung jetzt und auch perspektivisch mit Hilfe agrarökologischer Anbauverfahren zu ernähren.1 Doch die grüne Revolution, an die wir denken, wenn wir diesen Begriff hören, hatte Afrika niemals erreicht. Die »Grüne Revolution« Die Geschichte des Begriffes »Grüne Revolution« geht bis...
Lesezeit: 19 MinutenMalawi im Prisma der Welternährungskrise
von Peter Clausing Malawi, ein kleines Land im Herzen Afrikas, gehört mit seinen 14 Millionen Bewohnern zu den am dichtesten besiedelten Ländern Afrikas, nur übertroffen von Burundi, Gambia, Nigeria und Ruanda. Seine Ernährungsprobleme und die entsprechenden Lösungsversuche reflektieren eine ganze Reihe von Aspekten der globalen Ernährungskrise. Aufgrund des hohen Bevölkerungswachstums hat sich die Einwohnerzahl seit 1950 mehr als vervierfacht. Trotzdem liegt die Bevölkerungsdichte mit 120 Einwohner/km² noch immer deutlich unter der von Deutschland (229 Einwohner/km²). Malawi zählt zu den Least Developed Countries (LDC), einer sozialökonomischen Definition der UNO für die 48 ärmsten Länder der Welt. Trotz innenpolitischer Stabilität und obwohl das Land nicht vom „Ressourcenfluch“ heimgesucht ist, den der konservative Ökonom Paul Collier in fragwürdiger Weise als Wurzel allen Übels der Armut in Afrika betrachtet (1), hat das Land – seit langem ein Liebling der internationalen Entwicklungshilfe – es bis heute nicht geschafft, den LDC-Status zu verlassen. Schlimmer noch – in den letzten Jahrzehnten kam es wiederholt zu Hungersnöten, bei...
Lesezeit: 4 MinutenHunger – Katastrophe, Protest und Medienereignis
Wo liegen die Gründe für die skandalöse Diskrepanz zwischen Produktion und Versorgung? Von Peter Clausing Hunger ist die Alltagsrealität für ein Sechstel der Menschheit und – hungerbedingte Krankheiten mitberücksichtigt – die Todesursache für 10 Millionen Menschen jährlich. Spätestens seit der Explosion der Nahrungsmittelpreise 2007/2008 ist klar, dass das Milleniums-Entwicklungsziel, den Anteil der Menschen, die Hunger leiden, von 1990 bis 2015 zu halbieren, nicht annähernd erreicht werden wird. Statt zu einer Reduzierung kam es 2008 zu einem Anstieg der Zahl der Hungernden. Dabei wird Jahr für Jahr genügend produziert, um – statistisch betrachtet – alle Menschen mit ausreichend Nahrung zu versorgen.
Marktfrauen in Zomba, Malawi
Im Wettlauf gegen die Zeit
von Peter Clausing Bodenerosion und Welternährung Auch wenn, trotz über einer Milliarde hungernder Menschen, derzeit genügend Nahrung für die gesamte Weltbevölkerung produziert wird, zeichnet sich für die kommenden Jahrzehnte eine erhebliche Diskrepanz ab. Im Vergleich zu 1990 wird sich einerseits die globale landwirtschaftliche Nutzfläche bis 2025 um geschätzte 82 Millionen Hektar und damit um zehn Prozent vergrößern. Diese Erweiterung steht jedoch einem erwarteten Bevölkerungszuwachs von 60 Prozent in dem gleichen 35-Jahres-Zeitraum gegenüber. Zudem geht der Gewinn an landwirtschaftlicher Nutzfläche häufig mit der Zerstörung von Wäldern einher. Parallel dazu spielt sich eine stille Katastrophe sozusagen direkt unter unseren Füßen ab: Schätzungen zufolge sind weltweit 25 Prozent des Bodens von Degradation betroffen. 1 Dieser ernüchternden Statistik zum Trotz ist Weltuntergangsstimmung fehl am Platz. In seinem jüngsten Bericht an die UN-Vollversammlung schreibt der Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Olivier de Schutter, dass die Kleinbauern des Südens, also dort, wo chronischer Hunger am stärksten präsent ist, innerhalb von zehn Jahren ihre Nahrungsmittelproduktion verdoppeln...
Lesezeit: 4 Minuten