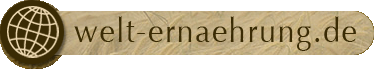Die Glyphosat-Kampagne: Workshop am 22./23.8.2016
Hinweis in „eigener Sache“: Workshop auf dem Klimacamp Kampagnen und „System Change“. Überlegungen mit Rückblick auf die Glyphosat-Kampagne 2015/2016 Workshopleitung: Leonie Sontheimer (Kampagne „Ackergifte? Nein Danke!“ und Peter Clausing (PAN Germany) Im April 2015 wurde die Wiedergenehmigung des Pestizids Glyphosat erneut öffentlich diskutiert – und damit die Argumente, die dagegen sprechen. Was mit vereinzelten Pressemitteilungen begann, ist innerhalb eines Jahres zu Hunderttausenden von Unterschriften und gemeinsamen Appellen von zig Organisationen aus zahlreichen europäischen Ländern gewachsen. In dem Workshop sollen rückblickend die Rahmenbedingungen einer erfolgreich verlaufenen Kampagne analysiert werden. Zugleich steht im Raum, dass eine erfolgreiche Kampagne noch keinen Systemwandel bedeutet. Basierend auf dieser Erkenntnis soll gemeinsam über den qualitativen Sprung von „Kampagne“ zu „Systemwandel“ reflektiert werden. Ablauf: • Vorstellungsrunde (20 Minuten) • „Glyphosat“ – Symptom einer Wachstumsgesellschaft: Was ist das Problem? (Impulsreferat & Diskussion, 60 Min) • Die Glyphosat-Kampagne: Entstehung, Erfolge, Misserfolge, „Lessons learned“ (Impulsreferat & Diskussion, 60 Min) • Von der Kampagne zum Systemwandel: Visionen, Voraussetzungen, Hindernisse (kurzes Input...
Lesezeit: < 1 MinuteGastbeitrag: Grüner Landraub durch Naturschutz
von Rene Vesper Hausarbeit bei Prof. K.-H. Erdmann, Geografisches Institut, Universität Bonn. Die Arbeit kann HIER herunter geladen werden. Nachstehend ein Auszug aus der Einleitung: Im 21. Jahrhundert blickt der globale Norden mit Demut auf die vergangenen zwei Jahrhunderte zurück, in denen im Zuge der Industrialisierung und Globalisierung die Ressourcen des Planeten in großem Stile ausgebeutet wurden. Während das Wissen um das Ausmaß globaler Umweltzerstörung zunimmt, wird der Ruf nach mehr Umweltschutz in der Öffentlichkeit lauter. Auch die weltweit größten Umweltschutz-Nichtregierungsorganisationen (NGOs) haben sich unlängst grüne Agenden auf die Fahnen geschrieben. Durch ein hohes Spendengeldaufkommen, eigene Umweltfonds, Umweltschutzprojekte und eigene Zertifikatsysteme haben sie einen großen Einfluss in Umweltdiskursen erlangt. Ihre Position im internationalen Umweltregime ist jedoch umstritten, da es in einigen ihrer Projekte zu gewaltvollen Vertreibungen und anderen Menschenrechtverletzungen kam (Schmidt-Soltau 2005, 284-285, In: Pedersen 2008, 32; CLA & VEG 2015). Da unlängst auch eine große Bandbreite von VertreterInnen aus der Industrie mit umweltfreundlichen Werbespots, Slogans und CSR-Umweltprojekten4 aufwarteten, stellt...
Lesezeit: 2 MinutenZur Fehlbewertung von Glyphosat durch Behörden und Industrie
Am 2.März 2016 wurde gegen das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), die in Parma, Italien, ansässige Europäische Lebensmittelbehörde (EFSA) und gegen die belgische Niederlassung von Monsanto, von der im Namen der „Glyphosate Task Force“ die Wiedergenehmigung des Pestizidwirkstoffs Glyphosat beantragt wurde, Strafanzeige erstattet. In einem Anhang zu dieser Anzeige wurde die fachliche Begründung für die in der Strafanzeige geäußerte Anschuldigung geliefert, dass Behörden und Industrie mit falschen Angaben versuchen, die Wiedergenehmigung von Glyphosat zu erreichen, obwohl dieses von der Krebsagentur der Weltgesundheitsorganisation (IARC) als „wahrscheinlich krebserregend beim Menschen“ eingestuft wurde.
Lesezeit: < 1 MinuteProfitables Ackergift
von Peter Clausing Das Verhältnis zwischen agrochemischer Industrie, landwirtschaftlichen Produzenten und Verbrauchern wirft nicht nur ein Schlaglicht auf den Zustand unserer Landwirtschaft, sondern auch auf den unserer Demokratie. Das lässt sich anhand des Streits um die weitere Genehmigung des Wirkstoffs Glyphosat, auch Bestandteil des Breitband-Unkrautvernichtungsmittels »Roundup«, zeigen, von dem bereits vor fünf Jahren bei einem Jahresumsatz von knapp 4 Milliarden US-Dollar etwa 610.000 Tonnen weltweit eingesetzt wurden. Eigentlich liegt es auf der Hand: Ökologischer Landbau ist klimafreundlicher und umweltverträglicher als die konventionelle Landwirtschaft. Eventuelle Mindererträge durch eine Umstellung auf ökologischen Landbau sind – je nach Kultur und Anbauverhältnissen – entweder überschaubar oder gar nicht vorhanden.1 Allerdings ist der Arbeitsaufwand im ökologischen Landbau in der Regel höher, was die Produktion verteuert. Doch angesichts von landwirtschaftlicher Überproduktion, Niedrigpreisen für konventionell produzierte Lebensmittel und der Tatsache, dass rund ein Drittel davon im Müll landet, fragt man sich, warum unsere Landwirtschaft nicht schon längst komplett auf Ökolandbau umgestellt wurde. Der macht derzeit statt dessen...
Lesezeit: 8 MinutenAgrarökologie – Definitionen, Kontext und Potenziale
von Peter Clausing – ursprünglich veröffentlicht auf globe-spotting.de im November 2015 – Vor einigen Jahren wurde Agrarökologie als „Wissenschaft, Bewegung und Praxis“ definiert (Wezel et al. 2009). Das bringt zum Ausdruck, dass das Konzept weitaus mehr beinhaltet als das, was in unseren Breiten landläufig hinter dem Begriff „Bio-…. “ gesehen wird. Die Bezugnahme auf „Bewegung“ bedeutet allerdings nicht, dass Agrarökologie automatisch mit gesellschaftlichem Umbruch und der Entstehung einer gerechteren Gesellschaftsordnung gleichzusetzen ist. Doch sicherlich ist sie ein ‚Trittstein’ auf dem Weg dorthin. Die ‚Scharnierfunktion’ der Agrarökologie zwischen Natur- und Gesellschaftswissenschaft existierte nicht von Anbeginn. Als der Begriff 1928 von dem sowjetischen Agronomen B.M. Bensin geprägt wurde, war damit ausschließlich Biologisches gemeint – das Zusammenleben von Organismen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen. Auch in der Tradition des Kieler Professors Wolfgang Tischler, der 1965 als erster ein Handbuch mit dem Titel Agrarökologie veröffentlichte, wird das Gebiet vornehmlich als biologisches Fach verstanden. Doch die Zeiten haben sich geändert. Francis et al (2003, 100) definierten diese...
Lesezeit: 6 MinutenPrivate Stiftungen – Speerspitze der globalen Agrarkonzerne?
Von Peter Clausing Die „neuen Philanthropen“, wie sich die Milliardäre des 21. Jahrhunderts nennen, schaffen mit ihren Stiftungen unter Umgehung demokratischer Entscheidungsprozesse die Voraussetzungen für die Ausdehnung der Märkte transnationaler Konzerne. Verbrämt durch einen Diskurs der Armutsbekämpfung, fördern sie die Entstehung einer neuen agrarischen Mittelschicht im subsaharischen Afrika, die ausreichend zahlungskräftig ist, um sich die Segnungen einer neuen Grünen Revolution leisten zu können. Mangel an Demokratie ist eine wesentliche Voraussetzung dafür. Zwar behauptet die Grüne Revolution 2.0, dass sie die afrikanischen KleinbäuerInnen aus der Armutsfalle ziehen wolle, doch gerade diese profitieren nicht davon! Die eigentlichen Nutznießer des neuen landwirtschaftlichen Booms sind – wie Untersuchungen in Kenia und Sambia zeigen – reiche Städter, in der Mehrzahl Regierungsangestellte, die sich in die Landwirtschaft einkaufen. Das erste Anzeichen für eine neue „Grüne Revolution“ gab es 1997, als Gordon Conway, der kurz darauf zum Präsidenten der Rockefeller-Stiftung ernannt wurde, sein Buch „The Doubly Green Revolution: Food for All in the Twenty-first Century”, veröffentlichte (1)....
Lesezeit: 14 MinutenDie Glyphosat-Kontroverse
Zum Streit um die Wiederzulassung des Pflanzengiftes in der EU nach der WHO-Warnung vor Krebsgefahr Von Peter Clausing Anfang August teilte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (European Food Security Authority, EFSA) mit, man werde sich mehr Zeit als geplant für eine Empfehlung zur Neuzulassung des Unkrautvernichters Glyphosat lassen. Die Einschätzung der Experten werde nicht, wie ursprünglich vorgesehen, am 13. August abgegeben, sondern erst Ende Oktober oder Anfang November, sagte ein Efsa-Sprecher am 5. August am Sitz der Behörde im italienischen Parma. Pestizidwirkstoffe unterliegen in der Europäischen Union alle zehn Jahre einem Wiederzulassungsverfahren, bei dem alle neu hinzugekommenen Erkenntnisse über mögliche Risiken für Gesundheit und Umwelt zu berücksichtigen sind. Diese Regelung ist ein Erfolg des jahrzehntelangen Kampfes von Umweltorganisationen. Sie hat aber nur bedingt zu einer Reduzierung des Einsatzes von Giften in der Landwirtschaft beigetragen, die gegen Pflanzen (Herbizide), Schädlinge (Insektizide) oder Pilze (Fungizide) wirken. Die Terminverschiebung bei der EFSA ist ein Indiz dafür, dass hinter den Kulissen heftige Debatten stattfinden....
Lesezeit: 4 MinutenLandgrabbing
Auf den 5. Heppenheimer Tagen zur christlichen Gesellschaftsethik ging es um Fragen des Bodeneigentums aus unterschiedlichsten Perspektiven Thesen zum Thema Landgrabbing von Peter Clausing 1. Einerseits wird die Verabschiedung der freiwilligen Leitlinien der FAO (Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security) im Jahr 2012 als großer Erfolg betrachtet, auch deshalb, weil diese Leitlinien sehr bald nach dem kritisierten Weltbankbericht zum Thema Landgrabbing (Deininger und Byerlee 2011) verabschiedet wurde. Andererseits kann Landgrabbing nicht losgelöst von anderen Politikfeldern betrachtet werden, die das Landgrabbing bedingen bzw. beeinflussen oder selbst vom Landgrabbing beeinflusst werden. Dazu gehören u.a.: – Handelspolitik allgemein, insbesondere aber die Liberalisierung von Börsengeschäften mit Nahrungsmitteln (Spekulation); – Politik bezüglich Ernährungsgewohnheiten (Fleischkonsum, Vergeudung von Lebensmitteln, Dumpingpreise); – Klima-, Energie- und Biodiversitätspolitik (Agrotreibstoffe, Landnutzungsänderungen, Schutzgebiete); – Förderung bestimmter Modelle landwirtschaftlicher Produktion (ungenügende bzw. nur Alibi-mäßige Förderung von Alternativen zu input-intensiver, profit-orientierter Landwirtschaft); – Migrationspolitik; – Informationspolitik (Beispiel: das Fehlen ökonomischer Hintergrundinformationen, inklusive...
Lesezeit: 10 MinutenViel Macht für wenige
Unter dem Titel »Wer hat die Macht?« wurde anlässlich des G-7-Gipfels eine Studie des Fair Trade Advocacy Office Brüssel zu Machtkonzentration und unlauteren Handelspraktiken in diesen Wertschöpfungsketten vorgelegt. Von Peter Clausing Wenn sich am 7. und 8. Juni die Staats- und Regierungschefs der G-7-Länder auf Schloss Elmau in Oberbayern treffen, wird auch die Gestaltung von Handels- und Lieferketten ein Gesprächsthema sein. Diese Strukturen werden gern als Wertschöpfungsketten bezeichnet, was suggeriert, dass alle Beteiligten etwas abbekommen. Besonders jene Prozesse, die unsere Ernährung berühren, spielen eine wichtige Rolle. Doch die »Wertschöpfung« ist ungleich verteilt. Am einen Ende der Kette befinden sich 2,5 Milliarden Menschen, deren Einkommen von der Landwirtschaft abhängt. Ein Großteil von ihnen trägt dazu bei, dass die globalen Warenströme fließen, oder wird von diesen beeinflusst. Am anderen Ende: 3,5 Milliarden Menschen, die in Städten leben und folglich ihre Lebensmittel kaufen müssen. Dazwischen agieren diejenigen, die den überwiegenden Teil des (Mehr-)Wertes abschöpfen: die Händler, die Aktionäre der Agrar- und Lebensmittelindustrie und...
Lesezeit: 3 MinutenLöst Glyphosat Krebs aus? – Wichtige Lücke in Risikobewertung deutscher Behörde
Hamburg und München, 15.04.2015. Eine aktuelle Recherche des Pestizid Aktions-Netzwerks (PAN Germany) deckt eine wichtige Lücke bei der Risikobewertung von Glyphosat durch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) auf. Demnach gibt es derzeit mindestens zehn Studien, die zeigen, dass Glyphosat in Zellen sogenannten „oxidativen Stress“ auslöst, der auch zur Krebsentstehung führen kann. Diesen Wirkungsmechanismus hat das BfR jedoch außer Acht gelassen. Dieses Versäumnis könnte ein Grund dafür sein, dass das BfR, anders als ein internationales Gremium der Weltgesundheitsorganisation (WHO), zu dem Schluss kommt, dass Glyphosat nicht krebserregend ist. Der Toxikologe Dr. Peter Clausing, der für das Pestizid Aktions-Netzwerk e. V. (PAN Germany) die vorliegenden Studien bewertet hatte, kritisiert: „Das BfR geht nur auf zwei Publikationen zum Thema oxidativer Stress ein, allerdings nicht im Zusammenhang mit einer möglichen Krebsentstehung. Mindestens acht weitere Untersuchungen aus den Jahren 2005 bis 2013, die über die Erzeugung von oxidativem Stress durch Glyphosat an Wirbeltieren wie Fischen, Kaulquappen, Mäusen und Ratten berichten, fanden überhaupt keine Erwähnung. Befunde...
Lesezeit: 2 Minuten