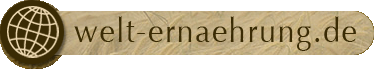Mexiko: Recht auf Nahrung – ein weiteres Lippenbekenntnis?
Katastrophale Auswirkungen der Freihandelsabkommen auf die Ernährungssituation in Mexiko
Von Peter Clausing
Mitte Oktober begrüßte Olivier de Schutter, UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, die Bekanntmachung Mexikos, eben diesem Recht Verfassungsrang einzuräumen. Bereits am Ende seiner im Juni durchgeführten Mexiko-Mission mahnte der UNO-Beauftragte mit Blick auf die anstehende Verfassungsreform „die weitere Verbesserung des juristischen Umfelds in Form einer Rahmengesetzgebung für das Recht auf Nahrung an, so, wie es in einer Reihe anderer Länder dieser Region bereits erfolgt ist“. Vor dem Hintergrund gravierender Missstände in den Bereichen Ernährung und landwirtschaftliche Produktion empfahl de Schutter eine nationale Strategie, um dem Recht auf Nahrung Geltung zu verschaffen.
Es stellt sich jedoch die Frage, ob die verfassungsmäßige Anerkennung des Rechts auf Nahrung nicht nur eine weitere Inszenierung im Kontext von Mexikos simulierter Demokratie darstellt. Schließlich hat Mexiko die Anti-Folterkonvention der UNO im Januar 1986 ratifiziert und akzeptiert bis heute unter Folter erzwungene Geständnisse als Beweismittel vor seinen Gerichten. Auch das landläufig als ILO-Konvention 169 bekannte „Übereinkommen über eingeborene und in Stämmen lebende Völker in unabhängigen Ländern“ aus dem Jahr 1989 wurde von Mexiko im Jahr darauf ratifiziert, ohne dass sich bis heute dadurch irgend etwas Wesentliches an der Situation von Mexikos Indígenas geändert hätte.
Die Verfassungsreform zum Recht auf Nahrung wurde am 17. August 2011 abgeschlossen. Sie betraf den Artikel 4 und (erneut) den Artikel 27 der mexikanischen Verfassung. Letzterer wurde Anfang der 1990er Jahre verändert, um die Privatisierung der kommunalen Ländereien zu ermöglichen – eine Vorleistung, um Mexikos Teilnahme am nordamerikanischen Freihandelsabkommen (NAFTA) zu ermöglichen. Dies war einer der Gründe für den zapatistischen Aufstand am 1. Januar 1994. In einer am 20. Oktober veröffentlichten Analyse identifizierte Laura Carlsen das NAFTA-Abkommen als einen wesentlichen Grund für den in Mexiko herrschenden Hunger. Der hat einen beträchtlichen Umfang und nimmt offenbar weiter zu.
Die Zahl der in „Ernährungsarmut“ lebenden Personen, also Personen, die es sich nicht leisten können, eine ausreichende Menge an Grundnahrungsmitteln zu kaufen, stieg von 18 Millionen Menschen im Jahr 2008 auf 20 Millionen Ende 2010. Etwa 20 Prozent der mexikanischen Kinder sind fehlernährt. De Schutter beklagt in seinem Bericht, dass gewisse Fortschritte in der Ernährungsfrage ungleich verteilt sind. Großen Teilen der Bevölkerung werde das Recht auf Nahrung „in dramatischem Ausmaß“ vorenthalten. Das betrifft in besonderem Maße die indigene Bevölkerung. In diesem Segment leidet ein Drittel der Kinder unter fünf Jahren an chronischer Fehlernährung – verglichen mit 11 Prozent bei nicht-indigenen Kindern.
All das sind deutliche Indikatoren für das Scheitern des Modells der Freihandelsabkommen, die Mexiko inzwischen mit über 40 Ländern abgeschlossen hat. Dem neoliberalen Dogma zu Folge gilt ein Land als „ernährungssicher“, so lange es genügend Werte produziert, um ausreichend Lebensmittel zu importieren. Die oben genannten Zahlen belegen, dass diese Rechnung nicht aufgeht, wenn anstelle von Preisstabilität auf der Basis einer soliden Eigenversorgung die Lebensmittelpreise den Fluktuationen des Weltmarkts folgen. Die Weltmarktpreise für die wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte haben inzwischen wieder die Rekordmarken von 2008 erreicht und teilweise überschritten.
Doch das Drama begann nicht erst mit der Preisexplosion für landwirtschaftliche Grundprodukte im Jahr 2008. Im Verlauf der nunmehr 17 NAFTA-Jahre mussten zwei Millionen Bauern ihr Land verlassen und wurden Teil des großen Exodus, der die USA jährlich mit einer halben Million neuer Arbeitskräfte im Billiglohnsektor versorgte. Inzwischen werden 42 Prozent der in Mexiko verzehrten Nahrungsmittel importiert. Während in der Zeit vor NAFTA weniger als zwei Milliarden US-Dollar für Nahrungsmittelimporte ausgegeben wurden, sind es inzwischen 24 Milliarden. Dementsprechend folgt der Preis für Mais, Mexikos wichtigstem Grundnahrungsmittel, dem Weltmarkt, wo Preisfluktuationen mittlerweile nicht mehr an die jährlichen Welterträge gekoppelt sind, sondern an andere Faktoren wie Börsenspekulation und Agrotreibstoffboom. Im Jahr 2009, als die Weltmarktpreise wieder nachgegeben hatten, kostete ein Kilo Mais zwei Pesos. Inzwischen hat sich der Preis wieder verdreifacht, und für ein Kilogramm Tortillas, das vor zwei Jahren drei Pesos kostete, müssen einem Bericht zufolge jetzt bis zu zwölf Pesos ausgegeben werden.
Ein eindrucksvolles Beispiel zu den Folgen der Marktliberalisierung liefert der Fall der US-Firma Corn Products International (CPI), die im Jahr 2003 den mexikanischen Staat beim NAFTA-Tribunal verklagte, weil sie Geschäftseinbußen aufgrund von Steuern auf den in Getränken verwendeten Fruktosesirup erlitten hätten. Nach einem jahrelangen Verfahren verurteilte die NAFTA-Behörde Mexiko 2008 zur Zahlung von 58,4 Millionen Dollar an CPI. Mais-Fruktosesirup, Bestandteil von Coca Cola und Chips, trägt eine wesentliche Mitverantwortung für den von Olivier de Schutter beschriebenen doppelten Ernährungsnotstand in Mexiko. Parallel zur oben beschriebenen Hungerstatistik sind 70 Prozent der Erwachsen – 35 Millionen Menschen – übergewichtig bzw. fettsüchtig. Die Folgeerscheinungen sind Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Nach Berechnungen des mexikanischen Gesundheitsministeriums hat dieses Phänomen im Jahr 2008 Kosten in Höhe von 4,9 Milliarden Dollar verursacht – für 2017 wird ein Anstieg auf 5,6 Milliarden Dollar erwartet.
Weitere vom UNO-Sonderberichterstatter beschriebene Probleme betreffen staatliche Förderprogramme, die Rechte von Tagelöhnern in der Landwirtschaft, Um- und Ansiedlungsprogramme im Rahmen von Entwicklungsprojekten, die Zulassung von Feldversuchen mit gentechnisch verändertem Mais und die Wasserverschwendung durch die industrielle Landwirtschaft. So beklagt de Schutter, dass ländliche Förderprogramme nur ungenügend auf die Armutsbeseitigung abzielen. Als Beispiel nennt er eine Zahl aus dem Jahr 2005, in dem die ärmsten sechs Bundesstaaten nur sieben Prozent der öffentlichen Ausgaben für die Landwirtschaft erhielten, obwohl sich dort 55 Prozent der in extremer Armut lebenden Bevölkerung befinden. In Bezug auf die zwei Millionen Landarbeiter, die ihren Lebensunterhalt als Tagelöhner verdienen und von denen 20 Prozent inländische Migranten aus den südlichen Bundesstaaten sind, kritisiert de Schutter sowohl mangelnde Sozialstandards wie den Zugang zu Schulen als auch das Fehlen von Arbeitsverträgen bei zirka 90 Prozent der Tagelöhner.
Während seiner Juni-Mission erhielt de Schutter zahlreiche Zeugnisse der Betroffenen von Entwicklungsprojekten (Dämme, Infrastruktur, Bergbau) im ganzen Land, die über fehlende Konsultation, das Nichteinholen ihrer freien und informierten Zustimmung und das Ausbleiben von Kompensationen klagten. Auf seiner Mission besuchte de Schutter auch die zwei bislang existierenden „ländlichen Städte“ (Ciudades rurales sustenables) Nueveo Juan de Grijalva und Santiago el Pinar. Von den mexikanischen Behörden werden die „ländlichen Städte“ als Konzept zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Überwindung von fehlender Schulbildung und Gesundheitsfürsorge infolge der Verstreutheit der Bevölkerung in ländlichen Regionen angepriesen. Soziale Organisation sehen darin eine Strategie der „weichen Räumung“ ländlicher Gebiete, um deren Ressourcen anschließend ungestört ausbeuten zu können.
Die derzeitige Landwirtschaftspolitik in Bezug auf Gentechnik und industriemäßige Anbauverfahren sieht der UNO-Sonderberichterstatter besonders kritisch. In Ursprungsland des Maises mit seiner Sortenvielfalt, wo die Bauern derzeit noch 85 Prozent des Maissaatguts durch Tausch erwerben (bei 5,2 Prozent Marktanteil der Saatgutindustrie) sende die Zulassung von Freilandversuchen mit gentechnisch veränderten Maissorten das falsche Signal und lenke von wichtigeren Themen wie Vermeidung von Bodenerosion und Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimaveränderungen ab. Gentechnische Feldversuche sind nach Ansicht de Schutters der erste Schritt eines schleichenden Prozesses, der unvermeidlich zum großflächigen Einsatz gentechnischer Sorten führen wird.
Neben der Gefahr des Sortenschwundes und der gentechnischen Verunreinigung der Landsorten verweist er auf die negativen Erfahrungen US-amerikanischer Farmer hinsichtlich Monsantos aggressiver Durchsetzung patentrechtlicher Ansprüche. De Schutter empfiehlt den mexikanischen Behörden, das Moratorium für Feldversuche schleunigst wieder einzuführen. Darüber hinaus kritisierte er das Subventionsprogramm Tarifa 9 durch das landwirtschaftliche Großunternehmen billigen Strom zum Abpumpen von Grundwasser erhalten. Durch diese Subventionen tragen die Unternehmen selbst nur 23 Prozent der Kosten für die Bewässerung. Ergänzt wird diese Politik durch ein Förderprogramm zum Ausbau der Infrastruktur der Bewässerung. Im Beispielsjahr 2006 wurden mehrere Hundert Millionen US-Dollar dafür ausgegeben. Das führte zur Erweiterung der Bewässerungsflächen auf 1,8 Millionen Hektar im Jahr 2011. Angesichts der Probleme, die landwirtschaftliche Bewässerungsprogramme weltweit in Form von Bodenversalzung und Absenkung des Grundwasserspiegels geschaffen haben, ist es nur logisch, dass der UN-Beauftragte empfiehlt, statt künstlicher Bewässerung die Etablierung von Systemen zur Rückhaltung von Regen zu unterstützen.
Dieser Beitrag erschien auf dem Portal amerika21.de